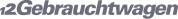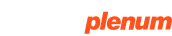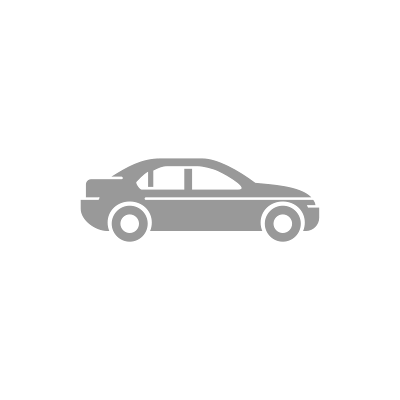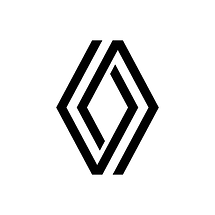Es geht in meinem Beitrag um einen Ford Mondeo MK 3. Es ist jene Modellreihe, die von 2001 bis 2007 gebaut wurde. Es handelt sich dabei um ein Firmenfahrzeug, welches hauptsächlich durch mich und meine unmittelbaren Mitarbeiter bewegt wird.
Ein Futura X mit Sichtpaket, wass nichts weiter bedeutet, dass ein Regensensor und eine Lichtautomatik mit an Bord ist. Der Wagen wurde im Februar 2007 zugelassen und ist damit einer der letzten seiner Art. Vielleicht begründet sich auch in dieser Tatsache die Fehlerfreiheit, mit der der Wagen uns beglückte.
Die Hülle
"Ein Opaauto" meinte meine bessere Hälfte, als ich den Wagen zum ersten Mal mit nach Hause brachte. Nun, als peppig würde ich sein Äußeres nun auch nicht unbedingt bezeichnen, aber das Facelift in 2005, bei der die Rückleuchten und die Stoßfänger überarbeitet wurden, gaben dem Wagen dann doch einen Hauch von Oberklassenluxus. Im Vergleich zu der Stufenheckversion, die mittlerweile gar nicht mehr angeboten wird, ist der Wagen jedoch deutlich attraktiver. Aber dies ist ohnehin Geschmackssache.
Etwas bedenklicher fand ich, dass beide Stoßfänger recht instabil und wabbelig wirkten, die Zeit hat jedoch gezeigt, dass sie ihrer Aufgabe gewachsen waren.
Die Front wirkte etwas harmonischer, als jener der ersten Modellreihe, bei der die kleinen runden Nebelscheinwerfer an Peter Lustig erinnerten.
Die Kabine
Im Innenraum findet man bereits viele Elemente/Schalter, die später im Nachfolgemodell MK4 verbaut wurden. Die Uhr in Form der Ford-Pflaume findet sich auch hier, jedoch ist das Zifferblatt nun dunkel und nicht mehr silber, wie beim Vorgänger. Eigentlich überflüssig, sich an einem solchen Detail aufzuziehen, aber genau dies tat die Fachpresse bei Erscheinen des Mondeo MK3 im Jahre 2000. Ich finde die Idee eigentlich gut und es ist eine erfrischende Alternative zu den faden Digitaluhren aktueller Modelle.
Die Materialanmutung und Verarbeitung des Armaturenbretts lässt keinen Grund zur Kritik zu. Die Flächen sind angenehm gepolstert und ich würde meinen, dass der Mondeo sich in diesem Punkt vor der deutschen Premium-Konkurrenz nicht verstecken muss. Die Geschwindigkeit und Drehzahl wird klassisch über zwei Rundinstrumente dargestellt. Ebenso die Kühlwassertemperatur und der Tankinhalt.
Damit sind die Anzeigeelemente fast erschöpft, wäre da nicht noch eine digitale Temperaturanzeige. Ein Bordcomputer steht einem in dieser Ausstattungslinie nicht zur Verfügung.
Die Sitze sind straff gepolstert und sie sind dies noch nach nunmehr knapp 180000 Kilometern, auch auf der Fahrerseite. Der Stoff wurde zu keiner Zeit durch Schonbezüge geschützt, Verschleißerscheinungen sind aber kaum vorhanden.
Es befindet sich links unterhalb des Lenkrades ein kleines Fach, in dem man hervorragend Kleingeld verschwinden lassen kann, jedoch wäre hier sogar Platz für die Geldbörse oder ein Handy. Die weiteren Ablagemöglichkeiten in der Mittelarmlehne und den Türen sind freilich auch vorhanden.
Die Knöpfe der Fernbedienung sind dort, wo sie hingehören, nämlich in fehlbedienungssicherer Lage in der Fahrertüre. Eine zentrale Sperrung der hinteren Fensterheber von dieser Stelle aus ist auch möglich. Einzig der Softlack auf den Tasten zeigte mit der Zeit einige ebenso kleine wie hässliche Blasen.
Besonders hervorheben möchte ich das praktische Brillenfach in der Dachmitte oberhalb des Innenspiegels.
Wie fährt er sich
Der Zweiliterdiesel entwickelt 131 PS, was den Wagen ausreichend flott macht. Für den Stadtverkehr und Überholmanöver im Überlandverkehr reicht es locker, ebenso wird auf der Autobahn Tempo 180 recht flott erreicht. Danach geht es etwas langsamer voran, bis bei Tacho 210- mit viel Rückenwind 220 km/h Schluss ist.
Der Motor bleibt dabei stets im Hintergrund und wird zu keiner Zeit lästig. Dies war bei dem Vorgänger mit dem TDDI-Motor noch der Fall. Er war noch nicht mit einer Commonrail-Einspritzung ausgestattet und klang neben dem TDCI-befeuerten Mondeo wie ein Lanz-Bulldog.
Für das gute und ausgewogene Fahrwerk ist der Mondeo ja hinlänglich bekannt und selbst fordfeindliche Fachzeitschriften attestieren dem Wagen eine hervorragende Straßenlage in allen Lebenslagen. Die Lenkung vermittelt ausreichend Fahrbahnkontakt und der Wagen liegt bei 200 km/h auf der Autobahn ebenso sicher, wie beim Durchfahren schweizer Serpentinen.
In meinem Bericht über den Civic habe ich über sein tolles Fahrwerk geschwärmt, aber ich bin fast geneigt zu sagen, dass der Mondeo hier die Nase vorne hat. Und dies, obwohl er sich eine Fahrzeugklasse höher bewegt.
Bei den Windgeräuschen jedoch hat der Mondeo wiederum das Nachsehen, aber wirklich penetrant wird der Geräuschpegel nie.
Der Motor
Der Zweilitermotor genehmigte sich immer 7 Liter. Das klingt komisch, kommt der Wahrheit jedoch ziemlich nahe. Das soll heißen, dass man den Schnitt nur bei extrem verhaltener Fahrweise unter 6.5 Liter bekommen konnte, jedoch auch ein hoher Tempo-Schnitt auf langen Autobahnetappen den Verbrauch kaum über 7.5 Liter auf 100 Kilometer treiben konnte. Wenn man das weiß, braucht man sich gar nicht anzustrengen. Wie bereits erwähnt, lief der Commonrail-Diesel angenehm leise und das dieseltypische Nageln war höchstens bei Kaltstarts und auch hier nur bei entsprechenden Außentemperaturen vernehmbar.
Der Störenfried
Der Ford Mondeo war einer der ersten, der mit einem werksseitig verbauten Rußpartikelfilter ausgestattet war. Eines schönen Tages kam einer meiner Mitarbeiter von einem Einsatz zurück und meinte, dass da "so ein komisches Zeichen" im Cockpit aufleuchtet. Jenes Zeichen war ein stilisierter Schraubenschlüssel, der nichts weiter aussagte, als das der Wagen nach einem Ölwechsel verlangt.
Was war passiert?
Wenn der Rußpartikelfilter zu sehr beladen ist, merkt der Wagen dies durch eine Differenzdruckmessung und versucht ihn durch die Nacheinspritzung von Dieselkraftstoff und der damit verbundenen Temperaturerhöhung freizubrennen.
Dieser Vorgang dauert etwa 10-15 Minuten, je nach aktuellem Fahrprofil und kann unter gewissen Umständen gar nicht abgeschlossen werden. Was er jedoch gar nicht mag ist, wenn man den Wagen während des Regenerationsvorgangs abstellt. Dann nämlich gelangt Dieselkraftstoff ins Motoröl, was man als nicht gesund bezeichnen könnte. Der Wagen zählt die Anzahl abgebrochener Regenerationsvorgänge und verkündet über die besagte Kontrollleuchte, dass er frisches Öl haben möchte.
Leider hielt es Ford nicht für erforderlich, den Fahrer über ein Lämpchen davon in Kenntnis zu setzen, wenn dieser Freibrennprozeß im Gange ist. Jedoch gibt es einige Anzeichen, wie ruckeliges Fahrverhalten oder ein brummiges Motorgeräusch, die verraten, dass der Filter gerade ausgebrannt wird. Nachdem wir wussten, auf was wir zu achten hatten, haben wir versucht, sofern es die Situation zuließ, durch eine Extrarunde, vorzugsweise auf der Autobahn, den Regenerationsprozeß abzuschließen. Danach wurden die Ölwechselintervalle von 20000 km immer erreicht.
Anmerken möchte ich zu diesem Problem, dass es zwar ein extrem nerviges, jedoch kein fahrzeugspezifisches Phänomen ist. Auch VW oder beispielsweise Mercedes hatten und haben damit zu kämpfen.
Die Störungen
Jetzt muss ich natürlich noch auf die außerplanmäßigen Werkstattaufenthalte eingehen. Es waren...ähm... war einer. Nicht jedoch aufgrund einer Störung, sondern wegen einer Rückrufaktion, bei der eine Hitzeschutzisolierung des Dieselpartikelfilters nachgerüstet wurde. Ansonsten war der Wagen nur zu besagtem Ölwechsel und den laufenden Inspektionen in der Werkstatt.
Fazit
Die aktuellen Gerbauchtwagenpreise liegen im Keller und ich kann freilich nicht versprechen, dass jeder Mondeo so zuverlässig unterwegs ist. Unserer ist es jedoch und es macht einfach Freude, wenn man sich auf ein Auto so sehr verlassen kann.
Im Bericht über den Honda Civiv habe ich beschrieben, wie es auch anders sein kann.
Ich sage ja zum Ford Mondeo 2.0 TDCI "Futura X"